Jenseits der Hitler-Tagebücher
Gerd Heidemann - mit diesem Namen wird der wohl größte Medienskandal in der Geschichte der Bundesrepublik verbunden. Dahinter steht allerdings auch die Erfolgsgeschichte eines legendären Berichterstatters, die auch heute noch ihresgleichen sucht. Im Gespräch mit dem Ex-"Stern"-Reporter Gerd Heidemann.

Gerd Heidemann im Hamburger Dokumenten- und Fotoarchiv.
Fotorechte: Gerd Heidemann)
Wer mit dem Namen Gerd Heidemann einzig die Affäre um die Hitler-Tagebücher und vermeintlich größten Schande im deutschen Journalismus in Verbindung bringt, der irrt. Der 1931 in Hamburg geborene Reporter begann in den 1950er Jahren als freier Fotoreporter und war von August 1955 bis Mai 1983 Reporter des Magazins „Stern“. Dort machte er sich als brillanter Recherche-Spezialist zu unzähligen brisanten Reportagen einen Namen. Mal kratze er kräftig am Establishment, um anschließend mittels akribischer Nachforschungen und Ermittlungen Fallstricke zu knüpfen, die selbst hochrangige Politiker in die Knie zwangen. Dann wieder „verdankten“ Politiker seinen spektakulären Aufdeckungen den verdienten Rücktritt. Explosive und heikle Hintergrundberichte zum Sturz des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt entstammten akribischer Recherchearbeiten des Teams, dem Heidemann als unverzichtbarer Bestandteil angehörte. Unvergessen bleiben auch seine Reportagen und Hintergrundberichte zum Fall Guillaume, der Affäre um den ehemaligen parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Karl Wienand, die akribischen Protokollierungen im Fall Hans-Martin Schleyer und dem Geiseldrama Mogadischu.

Gerd Heidemann – ein Reporter
will hoch hinaus. Hier für
Panorama-Fotos für
Hamburger Zeitungen
Foto: Heidemann/Archiv)
Schon in den 1960er Jahren arbeitete Heidemann im Auftrag des „Stern“ als Kriegsberichterstatter und lieferte Reportagen von den schaurigsten Kriegsschauplätzen der Welt. So berichtete er unter anderem aus Angola, Biafra, Mozambique, Guinea-Bissau und aus dem Kongo. Damals ahnte Heidemann noch nicht, dass ihn sein wohl größtes und persönliches Schlachtfeld später im Jahre 1983 ausgerechnet in der Heimat Deutschland erwarten sollte. Der Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher reihte sich ein in eine ganze Reihe von Medienschlampereien, die Leser weltweit, aber auch in Deutschland gelegentlich zu verdauen hatten.
Für Heidemann wurde das Tagebuch-Fiasko zu einer Zäsur in seinem bisher erfolggewohnten Leben und gereichte zum Stoff, aus dem die Albträume sind. Im Angesicht des zu erwartenden Medien-Spektakels, aber auch hoher Einnahmen, brannten im wahren Wortsinn sämtliche Sicherungen durch. Und dies nicht nur bei Heidemann, sondern im gesamten Verlag. Doch während andere Beteiligte und Verantwortliche eine weitere Chance bekamen und an früheren Erfolgen anknüpften, blieb der einstmalige Star-Reporter auf der Strecke und zahlte eine hohe Zeche: Jobverlust, Betrugs-Anklage, Haftstrafe und Verarmung. Statt einem Mindestmaß an Solidarität aus den eigenen Journalistenkreisen erntete der einstige Vorzeige-Journalist nur Schmach und Häme.
Jenseits der Hitler-Tagebücher bleibt die Erfolgsgeschichte eines legendären Berichterstatters, die auch heute noch ihresgleichen sucht. „Ein Reporter ist immer nur so gut wie seine letzte Geschichte“, äußerte Heidemann einmal. Und wer seinen lebhaften Worten zuhört, könnte beinahe glauben: Die Story über die gefälschten Hitler-Tagebücher war eine von vielen. Aber sie war nicht seine letzte Geschichte. Im Gespräch mit Gerd Heidemann, Journalist, Fotograf und Ex-„Stern“-Reporter.
Gerd Heidemann, wie geht es Ihnen und welche Themen und Projekte sind derzeit „Opfer“ Ihrer nie verlorenen Begeisterungsfähigkeit?

Gerd Heidemann 2018 im Büro des Archivs
in Hamburg (Foto: Marianne Heidemann)
Nach gründlichen ärztlichen Untersuchungen kann ich sagen, dass es mir in meinem Alter momentan gesundheitlich gut geht, was ja immer die Hauptsache im Leben ist.
Im Gegensatz zu vielen Kollegen und Menschen, die mich damals nach der Tagebuch-Pleite mit Häme und falschen Beschuldigungen überschütteten und die inzwischen ins Gras gebissen haben, lebe ich noch.
Wie heißt es so schön: „Wenn man seinen Feind nur um kurze Zeit überlebt, hat man schon gewonnen.“
Werden Sie sich noch einmal neuen Themen widmen, oder ist die Zeit als „Spürhund“ seit 1983 unwiderruflich vorbei?
Nein, neue Themen will ich zur Zeit nicht anpacken, denn ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit meinem umfangreichen Bild- und Dokumentenarchiv. Da das eine ruhige Arbeit ohne Stress ist und ich dabei nicht mehr unter Erfolgsdruck stehe, bin ich wahrscheinlich älter als mancher Journalist geworden. Man sagt ja, dass Journalisten allgemein keine hohe Lebenserwartung haben. Insofern kann ich froh sein, dass nach der Tagebuch-Pleite für mich eine ruhige Lebensphase begann. Wären die Bücher echt gewesen und hätte ich mein damaliges, ziemlich unruhiges Leben fortsetzen müssen, so hätte ich wohl auch schon längst das Zeitliche gesegnet. So muss auch niemand mehr befürchten, das Opfer meiner Begeisterungsfähigkeit zu werden, denn jetzt helfe ich höchstens Studenten bei ihren Arbeiten oder Historikern und Autoren bei ihren zeitgeschichtlichen Büchern mit Material aus meinem Archiv.
Lassen wir Ihre berufliche Vergangenheit ein wenig Revue passieren. Da gab es sozusagen zwei Leben. Eines vor 1983, das andere danach. Als erfolgreicher Reporter für den „Stern“ hat Sie – jenseits der Tagebücher – welche Geschichte am meisten beeindruckt, bewegt, gestresst und vielleicht auch zermürbt?

Gerd Heidemann auf dem
Weg zu einer steilen Karriere.
(Foto: G. Heidemann)
Am meisten hat mich die Suche nach B. Traven, den geheimnisvollen Schriftsteller*, beeindruckt, beschäftigt und zermürbt. Mein Chef Henri Nannen bestellte mich 1963 einmal zu sich und fragte mich: „Kennen Sie Traven?“ Ich antwortete ihm, ich wüsste nur, dass den eben niemand kennen würde und er wahrscheinlich in Mexiko leben würde. Darauf erzählte er mir von einer alten Dame, die sich über einen Mittelsmann bei ihm gemeldet hätte und behauptete, sie sei die ehemalige Ehefrau dieses Schriftstellers.
Als ich nun hoffte, nach Mexiko geschickt zu werden, wurde ich enttäuscht. Nannen schickte mich zu der alten Dame nach Hamburg-Iserbrook. Und dort begann nun aber eine jahrelange Recherche, die mich schließlich doch noch nach Brasilien und Mexiko führen sollte, wo ich Traven persönlich kennenlernen durfte. Das Endergebnis war eine fünfteilige Fernsehserie, die 1967 ausgestrahlt wurde, drei „Stern“-Veröffentlichungen und das Buch Postlagernd Tampico.
Zwar konnte ich auch beweisen, dass B.Traven mit dem ehemaligen Schauspieler und Revolutionär Ret Marut alias Richard Mauerhut identisch und ein illegitimer Spross der Hohenzollern war. Allerdings konnte ich nicht zweifelsfrei seinen Vater bestimmen.

Der junge Gerd Heidemann in den Anfängen seiner Reporter-Kariere.
Hier bei NOURUZ, dem Neujahrs- und Frühlingsfest am 21. März 1958
im Golestan-Palast in Teheran. Im Hintergrund die Botschafter der akkreditierten Länder.
(Fotorechte: Gerd Heidemann/Archiv)

Alles begann 1952 auf der Überfahrt mit der Fähre
von Civitavecchia/ Italien nach Olbia in Sardinien.
Damals wollte Heidemann über die Banditen auf Sardinien
berichten und war tagelang mit
Carabinieris auf Banditenjagd. Die Reportage,
die er damals als freier Journalist machte,
wurde die erste Veröffentlichung im Stern.
(Alle Fotos: G. Heidemann, Animation: SPREEZ)
Spätestens von da an wurden Sie als „der Spürhund“ bezeichnet. Speziell der Traven-Fall hielt Sie damals so gefangen, dass Sie auch dann weiter recherchierten, als der offizielle Auftrag durch den „Stern“ mangels Aussicht auf Erfolg bereits abgehakt worden war. Haben Sie Ret Marut alias B. Traven gefragt, warum er sich immer weiter versteckte, obwohl seine Fluchtgründe zu der Zeit ja keine Rolle mehr spielten?

(Foto: G. Heidemann)
Leider muss ich Ihnen sagen, dass ich Traven, der damals schon über 80 Jahre alt war, diese Frage nicht stellen durfte. Seine mexikanische Frau, die mir vorher verraten hatte, dass er ein Sohn des letzten deutschen Kaisers gewesen sei – was ich aber später durch anthropologische Gutachten nicht bestätigen konnte – versprach mir, dass sie mich mit ihm zusammen bringen würde, wenn ich folgende Bedingungen erfüllen würde: Er dürfe nicht wissen, dass ich Journalist sei, ich dürfe ihn nicht auf seine deutsche Vergangenheit ansprechen und auf keinen Fall verraten, dass ich darauf aus sei, sein Geheimnis über seine Abstammung zu lüften.
Wir vereinbarten, dass ich als Fotograf den deutschen Archäologen Ferdinand Anton nach Chiapas begleitet hätte. Diesen mexikanischen Staat hatte Traven ebenfalls 1925 als Fotograf einer Expedition besucht. Deshalb konnten wir auch bei einem gemeinsamen Abendessen im deutschen Restaurant „Bellinghaus“ in Mexico-City über seine und unsere Reise sprechen. Traven hatte 1928 darüber das Buch „Land des Frühlings“ geschrieben. Bei diesem Gespräch war Ferdinand Anton, der bereits viele Bildbände über die Mayas veröffentlicht hatte, ebenfalls dabei. Er schrieb auch das Drehbuch für die Fernsehserie und spielte in dieser Serie sich selbst, genauso wie ich den Reporter Heidemann spielte.
Während des Abendessens, das an meinem Geburtstag am 4. Dezember stattfand, verriet Traven nur einmal, dass er sich in München gut auskannte. Er fragte uns, ob die Bierkeller in München heute noch immer die gleiche politische Bedeutung wie damals nach dem ersten Weltkrieg hätten. Als Ret Marut war der später weltberühmte Autor B. Traven 1919 Mitglied des Revolutionstribunals gewesen. Er hatte die Sozialisierung der Presse, also die Enteignung, gefordert und war von der Münchener Staatsanwaltschaft wegen Hochverrats nach Sturz der Räteregierung im Mai 1919 verfolgt worden. Das war der Grund, weshalb er nach Mexiko geflüchtet und verschiedene neue Namen angenommen hatte.

Auf den Spuren B.Travens in Chiapas/Mexiko. Interview mit Travens früherer Vermieterin
in Comitan, Ernestine Gonzales, bei der B. Traven ca. 1925 wohnte. Im
Vordergrund mit Rücken zur Fotokamera: Amador Panyangua, Travens
früherer Reisebegleiter, der Traven ca. 1925 durch
den Staat Chiapas begleitete. (Fotorechte: Gerd Heidemann/Archiv)
Die „Story“ wurde ein ebenso großer Erfolg, wie Ihre spätere Kriegsberichterstattung. Was war der Auslöser für diesen Ressort-Wechsel mit natürlich enormen physischen und psychischen Herausforderungen? Glaubte Henri Nannen, wer B. Traven aufspüren kann, ist aus dem Holz geschnitzt, auch die schwerste aller Diszipline im Journalismus in Angriff zu nehmen? Und haben Sie sofort zugesagt?

Von der Einschulung 1938 bis zum mutigen
Einsatz als Kriegsberichterstatter
im Kongo vergingen rund 25 Jahre
(Fotos: Heidemann Archiv)
Schon zwei Jahre vor der Begegnung mit Traven, die im Dezember 1966 stattfand, habe ich bereits meine ersten Kriegsabenteuer im Kongo erlebt. Henri Nannen hatte uns dann im September 1964 gefragt, wer Lust hätte, in den Kongo zu fliegen, um dort nach den weißen Söldnern zu forschen. Die kämpften unter dem deutschen Hauptmann Siegfried Müller irgendwo im Urwald gegen die Rebellen.
Drei Mann meldeten sich freiwillig. Mit dem Kollegen Ernst Petry, der die Geschichte schreiben wollte, und dem Pressefotografen Dieter Heggemann flog ich nach Leopoldville, der Hauptstadt des Kongo. Dort trennten wir uns. Heggemann flog nach Kamina in Katanga, wo die Söldner ausgebildet wurden. Er hatte leider das Pech, das man ihn im Militärcamp ins Casino einlud und seine Kameratasche unter Verschluss nahm. Und sie wurde ihm erst wieder kurz vor dem Rückflug ausgehändigt. So konnte er nur in der Hauptstadt auf uns warten, denn wir waren mit einer gecharterten Maschine nach Coquilhatville geflogen und hatten dort die ersten verwundeten Söldner getroffen.
Sie erzählten uns, dass Müller mit 30 Mann etwa 700 Kilometer entfernt im Urwald kämpfte. Wir besorgten uns ein Fahrzeug und fuhren einige hundert Kilometer bis Ingende. Dort trafen wir auf eine Gruppe desertierter Söldner, denen die Sache nach den ersten eigenen Verlusten zu heiß geworden war und die sich hinter einem Fluss verschanzt hatten. Sieben Mann überredete ich, mit mir wieder zu Hauptmann Müller durchzustoßen. denn ich hatte keine Lust, 350 Kilometer allein durchs Rebellengebiet zu fahren. Die „Hauptstraße“ – eigentlich nur ein Feldweg durch den Urwald – lief übrigens direkt auf dem Äquator entlang.
Als ich Müller die Leute zurück brachte, war er mir sehr dankbar und duldete meine Anwesenheit, denn eigentlich war vom Hauptquartier verboten worden, Journalisten bei den Kämpfen mitzunehmen. Am nächsten Tag kamen auch die restlichen Söldner reumütig aus Ingende zu Müller zurück, und so bestand das „Commando 52“ wieder aus 30 Mann. In der nächsten Zeit erlebte ich dann die Kämpfe mit, während mein Kollege Ernst Petry einige Wochen in der Provinzhauptstadt Coqilhatville auf mich wartete.

Alle Fotorechte Gerd Heidemann, Animation SPREEZ
Dabei entstand die Fotoreportage, für die Sie große Auszeichnungen erhielten?
Ja, für die Fotoreportage bekam ich 1965 in Den Haag den ersten Preis und die Goldmedaille von „World Press Photo“. Die Fotos wurden in der ganzen Welt nachgedruckt. Vorher, im November/Dezember 1964, war ich dabei, als belgische Fallschirmjäger in Stanleyville/Kongo die weißen Geiseln befreiten und ich musste zusehen, wie kongolesische Soldaten unschuldige Zivilisten massakrierten. Ziemlich deprimiert kam ich nach all diesen grausigen Erlebnissen nach Hamburg zurück. Enttäuscht war ich, als ich Nannen die Fotos vorlegte, er sie im Schoß umblätterte und nur bei jedem vierten oder fünften Foto einmal kurz nach unten blickte. Dann unterhielt er sich dabei weiter mit seine Redakteuren und bemerkte nur: „Ach, immer diese toten Neger. Heidemann ist ein zu guter Journalist, der wird verstehen, dass wir kurz vor Weihnachten solche schlimmen Bilder nicht veröffentlichen können.“
Kurz darauf kam der kongolesische Ministerpräsident Tschombe nach Deutschland und sprach im Rhein-Ruhr-Club. Alle Zeitungen berichteten über den Kongo und Nannen schimpfte, dass man meine Fotos in einer großen „Stern“-Geschichte hätte veröffentlichen müssen. Als ich mir die Bemerkung erlaubte, er sei es doch gewesen, der solche Fotos um die Weihnachtszeit nicht im Blatt sehen wollte, belehrte er mich: „Man muss nicht nur gute Fotos machen wie Sie, man muss sie hier auch gut verkaufen können!“

Fotowand bei World Press Photo in Den Haag. Für die Kongo-Reportage
erhielt Gerd Heidemann 1965 den ersten Preis und die Gold-Medaille.
(Fotorechte: Gerd Heidemann / Archiv)
War die Zusammenarbeit mit Henri Nannen mitunter schwierig oder könnte man sagen, es war zwar nicht einfach, aber er war eben der Impulsgeber?
Für seine Mitarbeiter war er der „Große Zampano“. Gemeint ist dieser lautstarke und sich gern in Szene setzende Mann aus dem berühmten Film „La Strada“, der heute als Synonym für einen Menschen gilt, der die Fäden zieht und andere Menschen nach seinen Vorstellungen tanzen lässt. Zufällig war ich einmal in seinem Zimmer, als seine Sekretärin am Telefon eine Einladung ihres Chefs zu einer Tagung von deutschen Chefredakteuren entgegennahm und zu Nannen sagte: „Herr Nannen, Sie sind als Chefredakteur ebenfalls dazu eingeladen.“ Und da hörte ich, wie Nannen diese Einladung barsch ablehnte. „Ich bin kein Chefredakteur, ich bin Henri Nannen!“
Er forderte also neben Höchstleistungen vor allem auch Respekt?
Ja und fast alle seine Reporter und Redakteure hatten in seiner Gegenwart auch ungeheuren Respekt vor ihm, konnte er doch manchmal sehr lautstark seine Kritik äußern und gelegentlich sogar einen richtigen Wutanfall bekommen. Und jeder buhlte um seine Gunst und Anerkennung, um aber in seiner Abwesenheit dann umso kräftiger über ihn zu lästern. Sobald sich „Stern“-Leute trafen, war er ohnehin das Hauptgesprächsthema.

Henry Nannen und Gerd Heidemann – Bruch nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit.
Anlass war der Skandal um die gefälschten Hitlertagebücher.
(Foto: Archiv Heidemann/Hamburg)
Mein Kollege und Freund Donald Ahrens, der einige Zeit lang unser Korrespondent in München war und danach zur „Quick“ abwanderte, sagte mir einmal: „Du bist nur so zäh bei Deinen Recherchen und Reportagen und deshalb so erfolgreich, weil Dir Nannen ständig im Nacken sitzt und Du alles auf Dich nimmst, um ihn nicht zu enttäuschen. Ohne Nannen wärst Du bestimmt völlig anders. Also, bleib´ bloß beim „Stern“ und geh nie zu einer anderen Illustrierten!“
Immerhin – Sie blieben fast drei Jahrzehnte.
Ja, doch obwohl ich Ahrens durchaus beipflichtete, kündigte ich im Laufe meiner dreißigjährigen Tätigkeit beim „Stern“ mehrmals meinen Vertrag, ließ mich aber leider immer wieder durch Nannen mit guten Worten und mehr Geld überzeugen, den „Stern“ nicht zu verlassen. Bei der vorletzten Kündigung im Jahre 1976 sagte Nannen zu mir: „Gerd, Sie haben sich 20 Jahre lang keinen Fehler geleistet, haben uns vor vielen Prozessen durch ihre genauen Recherchen bewahrt – wann immer Sie in Zukunft einen Fehler machen werden, ich werde immer hinter Ihnen stehen!“
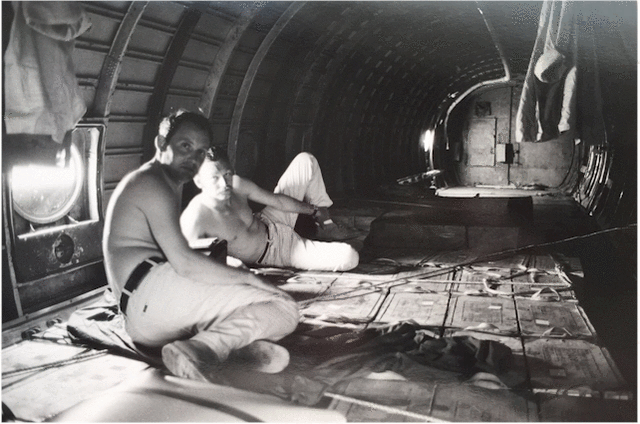
Foto 1: Heidemann mit einem Kollegen in einer alten DC-4, auf Munitionskisten liegend,
weil das Flugzeug Munition nach Biafra transportierte – von Lagos nach Port Harcourt.
Auf dem Rückflug, als die beiden nicht mehr an Bord waren, stürzte die
Maschine ab. Die beiden schwedischen Piloten kamen ums Leben.Foto 2 und 3:
Gerd Heidemann mit portugiesischen Marine- Füsilieren in Guinea-Bissao im März 1971.
(Alle Fotorechte: G. Heidemann/Archiv)
Dabei verschwieg Nannen den Dolch in seiner Hand, denn er war der erste, der nach der Tagebuch-Pleite Strafanzeige gegen mich stellte. Weil er glaubte, ich hätte den Verlag betrogen, indem ich für den Tagebuch-Beschaffer einen Allerweltsnamen genannt hätte. Konrad Kujau, der Tagebuchfälscher, hatte sich in Stuttgart fast 20 Jahre lang Konrad Fischer genannt, und so kannte ihn auch sein Freunde- und Bekanntenkreis und natürlich auch ich. Und diesen Namen hatte ich natürlich der Verlagsleitung ebenfalls genannt. Nannen, der mir einmal gesagt hatte: „Wir können die ganze Welt belügen, nur unter uns müssen wir uns die Wahrheit sagen“, dachte nun, ich hätte die Verlagsleitung belogen.
…wir sprechen nicht von den gefälschten Tagebüchern, jedenfalls nicht jetzt.
Gut, doch was nun seine Wahrheitsliebe angeht – und das will ich damit ausdrücken – sind mir einige Beispiele in Erinnerung geblieben. In den 50er Jahren landete einmal ein wunderschönes Foto „Chicago bei Nacht“ auf seinem Schreibtisch. Nannen wollte es unbedingt veröffentlichen. Es fehlte nur ein sogenannter „Aufhänger“, wie es in unserer Sprache hieß. Doch der fiel Nannen ein. Ein Mann weiß, dass er operiert werden muss, um einen lebensgefährlichen Tumor zu entfernen. Doch durch die Operation wird er sein Augenlicht verlieren. Sein Wunsch vor dem Blindsein lautet: Er möchte noch einmal Chicago bei Nacht sehen. Und dieser Wunsch wird ihm erfüllt. Mit etwa diesem Text, wenn ich mich richtig erinnere, wurde das Foto im „Stern“ veröffentlicht.

Foto 1: Gerd Heidemann beim Söldner-Commando 52 im Kongo
im September/Oktober 1964. Foto 2 und 3: Gerd Heidemannn mit dem
portugiesischen General Kulza Oliveira de Ariaga im Nov./Dez. 1970,
der Oberkommandierender in Moçambique war und
während seines Aufenthaltes die Operation „Gordischer Knoten“ leitete.
Diese sollte die FRELIMO aus den nördlichen Provinzen vertreiben. An dieser
Operation nahm Heidemann als Fallschirmjäger teil. (Fotorechte: G. Heidemann/Archiv)
Oder eine andere für Nannen typische Reaktion. In den 60er Jahren konnte ich sechs Jahre lang keinen Urlaub nehmen, weil immer wieder neue Recherche- und Reportageaufträge, die mir Nannen erteilte, wichtiger waren. Jedes Mal zahlte mir Nannen den Urlaub in bar aus. Im siebten Jahr wagte ich erst gar nicht, um Urlaub zu bitten, sondern ging zu Nannen und bat ihn wieder um finanzielle Gegengenleistung für den Urlaubsverzicht. Was entgegnete er mir? „So etwas kommt gar nicht in Frage, das machen wir grundsätzlich nicht!“ Man konnte sich nie auf eine vorhergehende Äußerung Nannens berufen, denn er übertrumpfte noch Adenauer, indem er sich den Spruch, „was kümmert mich mein Geschwätz von vor zehn Minuten“ zu Eigen gemacht hatte. Während unser erster Bundeskanzler wenigstens nicht an sein Geschwätz von gestern erinnert werden wollte.
Andererseits – Nannen vertraute Ihnen die brisantesten Recherche-Fälle an. Im eigenen Land und als Kriegsberichterstatter. Im steten Wechsel?
So war es. Bis zum israelischen Sechstagekrieg im Juni 1967, durfte ich wieder ganz normale Themen recherchieren und fotografieren. Ich recherchierte Mordfälle, musste Albert Speer aus dem Spandauer Gefängnis abholen, für eine Serie über prominente Mutter und Töchter recherchieren und vieles mehr. Dann, im Israel-Krieg, war ich auf der jordanischen Seite und musste aufpassen, dass ich nicht Napalm auf den Kopf bekam.
Später erfolgten wieder Recherchen über deutsche Krankenhäuser, Interviews mit Chefärzten und vieles mehr, bis es wieder einmal in den Kongo und nach Ruanda ging. Denn dort führten die letzten Söldner, die gemeutert hatten, ihren letzten Kampf in Bukavu am Kivu-See gegen die kongolesische Nationalarmee. Danach durfte ich mich mit dem schönen Konsul Hans-Hermann Weyer für die „Stern“-Serie „Dekorateur der deutschen Gesellschaft“ beschäftigen. Henri Nannen ließ sich von mir das 147 Seiten lange Interview mit Weyer geben und nahm es über Ostern mit nach Hause. Er, der sonst nie mehr als eine Seite lesen wollte, schien es wirklich gelesen zu haben. Vor der versammelten Mannschaft in der „Stern“-Konferenz, die täglich um die Mittagszeit stattfand, erklärte er, er habe noch nie eine so spannende Geschichte wie dieses Interview gelesen.

Gerd Heidemann mit Konsul Hans Hermann Weyer in einem Hotel in
Kampala/Uganda und in einem kleinen Flugzeug auf dem
Flug von Bujumbura/Burundi nach Cyangugu am Kivu-See in Ruanda
(Fotorechte: Gerd Heidemann/Archiv Hamburg)
Und was ist dran an der Legende, Henri Nannen habe bestimmte Reportagen zu Hause von der Schwiegermutter lesen und beurteilen lassen, bevor er sie freigab?
Nannen erwähnte oft, dass seine Schwiegermutter einen bestimmten Artikel nicht für gut befunden oder nicht richtig verstanden hätte.
Wenn es um bestimmte Themen ging, die er für den „Stern“ interessant fand, begann er auch meistens mit dem Satz: „Ich habe heute morgen auf der Toilette „BILD“ gelesen und da etwas gefunden.“
Lesen Sie in Teil II: Kriege werden am Schreibtisch geplant
Das Gespräch führte Ursula Pidun
Empfehlung:
Personalisierter Nachrichten-Stream von den besten Nachrichtenquellen. Finden Sie hunderte lizenzierte Informationsquellen wie dpa, Berliner Morgenpost, SPREEZEITUNG Berlin, Hamburger Abendblatt, WAZ, Tag24, Watson und andere mit der Nachrichten-App:
+++News Republic+++
